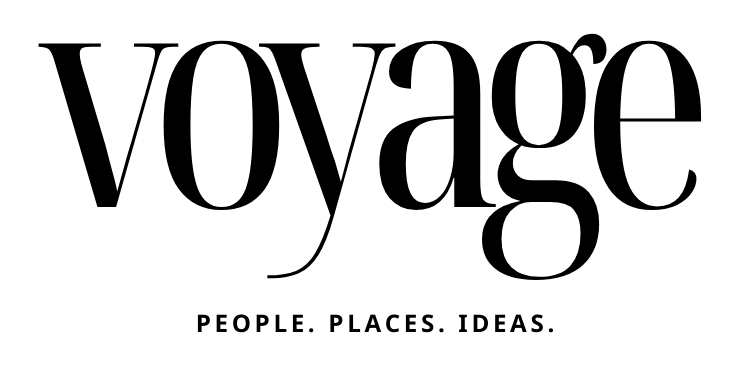Richard David Precht ist kein Randphänomen.
Er ist kein politischer Außenseiter.
Und er ist auch kein radikaler Denker.
Gerade deshalb ist seine Rolle im gegenwärtigen Diskurs so aufschlussreich.
Richard David Precht steht exemplarisch für eine Entwicklung, die viele spüren, aber nur wenige präzise benennen: den schleichenden Verlust eines offenen, differenzierten Meinungskorridors – nicht durch staatliche Zensur, sondern durch Sprache, durch Bequemlichkeit und durch eine gesellschaftliche Dynamik, die Abweichung zunehmend sanktioniert.
Es ist nicht das, was nicht mehr gesagt werden darf, das irritiert.
Es ist die Geschwindigkeit, mit der entschieden wird, wer jemand ist, sobald er etwas sagt.
Wenn Denken unbequem wird
In den vergangenen Jahren hat sich der Ton öffentlicher Debatten spürbar verändert. Diskussionen über Corona, den Ukrainekrieg, Migration, soziale Gerechtigkeit oder geopolitische Verantwortung folgen immer seltener einer argumentativen Logik. Stattdessen bewegen sie sich entlang moralischer Raster.
Positionen werden nicht mehr geprüft, sondern verortet.
Nicht widerlegt, sondern etikettiert.
Nicht diskutiert, sondern vorschnell eingeordnet.
Begriffe wie „rechts“, „problematisch“, „unsensibel“, „russlandfreundlich“ oder „nicht anschlussfähig“ wirken dabei weniger als analytische Kategorien denn als soziale Marker. Sie entscheiden darüber, ob jemand weiterhin Teil des Gesprächs bleibt – oder in eine Ecke gestellt wird, aus der kaum mehr herausargumentiert werden kann.
Precht bewegt sich genau an dieser Bruchlinie. Nicht, weil seine Positionen extrem wären, sondern weil sie nicht bequemsind.
Precht als Spiegel einer bequemen Öffentlichkeit
Dass Precht in klassischen Talkshow-Formaten seltener auftaucht, ist kein Zufall. Es ist auch keine Frage mangelnder Relevanz. Es verweist auf ein mediales Klima, in dem bestimmte Fragen zwar theoretisch erlaubt sind, praktisch aber als anstrengend gelten.
Precht denkt nicht in Lagern.
Er denkt in Spannungen, Zielkonflikten und offenen Enden.
Und genau das ist nicht bequem.
Nicht für Formate, die klare Narrative brauchen.
Nicht für Debatten, die schnelle moralische Orientierung verlangen.
Und nicht für eine Öffentlichkeit, die sich an Eindeutigkeit gewöhnt hat.
Vielfalt ist sichtbar – und doch erstaunlich begrenzt
Es wäre falsch – und bequem –, so zu tun, als gäbe es keine Meinungsvielfalt mehr.
Sie ist sichtbar. Sie findet statt. Sie wird sogar bewusst inszeniert.
Podien sind divers besetzt.
Parteien werden eingeladen.
Unterschiedliche politische Farben sitzen nebeneinander.
Gerade in öffentlich-rechtlichen Medien wird ernsthaft versucht, politische Breite abzubilden. Diese Bemühungen sind real – und sie verdienen Anerkennung.
Und dennoch bleibt ein merkwürdiges Gefühl zurück:
Man hört viele Stimmen – aber oft dieselben Deutungsrahmen.
Vielfalt ist vorhanden.
Diskursbreite deutlich seltener.
Wenn Vielfalt zur Kulisse wird
In vielen Formaten darf Unterschiedliches gesagt werden – solange es nicht zu unbequem wird. Abweichung ist erlaubt, solange sie den grundlegenden Erwartungshorizont nicht verlässt. Wer diesen Rahmen überschreitet, gilt nicht als konträr, sondern als exotisch.
Oder, moderner formuliert: als nicht anschlussfähig.
Das ist keine Verschwörung.
Das ist eine Komfortzone.
Ein Abend im Hangar – und ein leiser Erkenntnismoment
Ich gebe es offen zu:
Ich habe es sehr genossen, als bei Talk im Hangar-7 die österreichische Außenministerin Beate Meinl-Reisingergemeinsam mit Richard David Precht am Tisch saß.
Nicht, weil ich mir Einigkeit erwartet hätte.
Sondern weil sich dort etwas sehr Lehrreiches zeigte.
Precht formulierte Thesen, wie er es immer tut: ruhig, differenziert, tastend. Keine Parolen, keine Provokationen, kein rhetorisches Feuerwerk. Und dennoch hatte man über weite Strecken den Eindruck, seine Gedanken bewegten sich außerhalb eines Koordinatensystems, das im österreichischen Politikbetrieb noch ernsthaft anschlussfähig wäre.
Sie wurden nicht wirklich widerlegt.
Sie wurden auch nicht vertieft diskutiert.
Sie wirkten vor allem: utopisch. Exotisch. Fremd.
Fast so, als hätte jemand aus Versehen einen Philosophen in eine politische Verwaltungsrunde gesetzt.
Exotik als Abwehrmechanismus
Nicht, weil Precht recht hätte oder nicht.
Sondern weil seine Gedanken offenbar nicht mehr in die operative Logik der österreichischen Politik passen.
Wer nicht sofort umsetzbar ist, gilt als unrealistisch.
Wer nicht in Legislaturperioden denkt, gilt als weltfremd.
Wer Fragen stellt, wo andere Abläufe verwalten, wird belächelt.
Das ist kein Zeichen politischer Stärke.
Es ist ein Symptom politischer Verengung.
Die große Moralkeule
An die Stelle argumentativer Auseinandersetzung ist vielerorts die große Moralkeule getreten. Moral wird nicht mehr als Orientierung genutzt, sondern als Abkürzung.
Wer moralisch eindeutig urteilt, spart sich Differenzierung.
Wer moralisch zuschlägt, entlastet sich vom Denken.
Dabei muss eines klar gesagt werden:
Moral hat bei einem brutalen, völkerrechtswidrigen Angriffskrieg – wie jenem Russlands – keinen ordnenden Platz. Sie ist keiner Befriedung dienlich. Sie kann Gewalt nicht beenden. Und sie ersetzt keine macht- und sicherheitspolitische Realität.
Doppelmoral als Dauerzustand
Unsere Gesellschaft lebt seit Jahrzehnten mit funktionierenden Doppelmoralen. Sie sind etabliert, akzeptiert, gesellschaftsfähig.
Der Kapitalismus hat eine eigene Moral hervorgebracht:
Wenn persönlicher Vorteil entsteht, gilt es als legitim, dem Gegenüber etwas zu entziehen. Wird Kapital geschlagen, heißt das Leistung. Erfolgt Umverteilung unter sozialem Deckmantel, werden genau jene, die das System zuvor bedient haben, moralisch problematisiert.
Das System ist am Anschlag.
Es ist kein Treiber eines moralischen Zeitalters – sondern ein Produzent struktureller Widersprüche.
Die antrainierte Unfähigkeit zu vertrauen
Precht beschreibt diesen Zustand eindrücklich, unter anderem im Podcast Lanz & Precht: eine antrainierte Kultur des Misstrauens.
Vertrauen gilt als naiv.
Misstrauen als klug.
Doch ohne Vertrauen gibt es keinen Diskurs.
Und ohne Diskurs keine Demokratie.
„Wie kann man die AfD bekämpfen?“ – falsche Frage
Nicht: Wie können wir sie bekämpfen?
Sondern: Warum sind wir unwählbar geworden?
Diese Verschiebung ist entscheidend.
„Bekämpfen“ setzt einen Feind voraus.
Demokratie kennt Gegner, keine Feinde.
Solange Parteien wie die Alternative für Deutschland oder die Freiheitliche Partei Österreichs demokratisch wählbar sind, ist jede Bekämpfungsrhetorik vor allem eines: eine bequeme Ausweichbewegung.
Sie erspart die unangenehme, aber notwendige Selbstbefragung.
Wähler sind keine Gegner
Es wäre politisch klüger – und menschlich reifer –, sich mit der Wählerschaft dieser Parteien differenziert und mit Verständnis auseinanderzusetzen. Nicht um Positionen zu übernehmen, sondern um Motive zu verstehen.
Verständnis ist keine Zustimmung.
Verständnis ist die Voraussetzung dafür, dass jemand überhaupt zuhören kann.
Nach Jahren der Ausgrenzung und Schubladisierung ist es für viele AfD- und FPÖ-Wähler kaum mehr möglich, sich öffentlich zu erklären. Eine Demokratie, die ihre Wähler moralisch aussortiert, verliert nicht nur Stimmen – sie verliert Gesprächspartner.
Die eigentliche Leerstelle: Profil, Verantwortung, Scheiterkultur
Parteien werden nicht über Nacht unwählbar.
Unwählbarkeit entsteht durch fehlendes Profil, durch austauschbare Sprache, durch moralische Überhöhung – und durch das konsequente Vermeiden eigener Fehler.
Eine Demokratie ohne Fehler- und Scheiterkultur verlernt zu lernen.
Und eine Politik ohne Selbstkritik erzeugt Protest.
Warum Precht relevant bleibt
Prechts Bedeutung liegt nicht darin, recht zu haben.
Sie liegt darin, nicht bequem zu sein.
Er verweigert die große Moralkeule.
Er hält Widersprüche offen.
Er erinnert daran, dass Denken Zeit braucht.
Sprache als Voraussetzung von Demokratie
Die zentrale Frage lautet nicht, wie man Parteien bekämpft.
Sondern wie wir wieder lernen, miteinander zu sprechen, ohne einander zu Feinden zu erklären.
Demokratie beginnt nicht bei Moral.
Sie beginnt bei Verantwortung, Differenzierung – und Vertrauen.
VOYAGE
VOYAGE ist kein moralisches Tribunal.
Es ist ein Ort der Einordnung.
Nicht alles, was gesagt wird, ist richtig.
Aber alles, was demokratisch sagbar ist, muss sagbar bleiben.
Nicht Moral erlöst uns.
Sondern Sprache. Und der Mut, ihr wieder zu vertrauen.