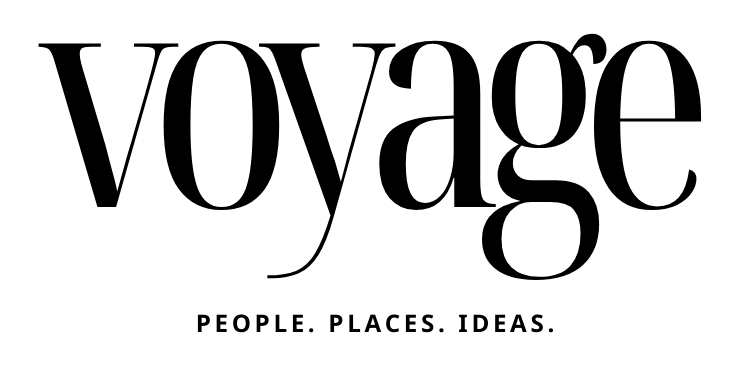Warum die globale Sicherheitsordnung nicht reformiert, sondern neu definiert wird
Heidelinde Dvoracek
Das Ende der Gewissheiten
Die Welt befindet sich nicht in einer Phase temporärer Instabilität. Sie erlebt einen systemischen Übergang. Was über Jahrzehnte als verlässlich galt – territoriale Souveränität, multilaterale Institutionen, wirtschaftliche Interdependenz als Friedensgarantie, liberale Demokratien als Endpunkt politischer Entwicklung – wird nicht mehr nur infrage gestellt, sondern zunehmend praktisch außer Kraft gesetzt.
Die zentrale Verschiebung liegt weniger in einzelnen Konflikten als in der Erosion normativer Selbstverständlichkeiten. Die Annahme, dass das historisch Erprobte auch künftig Gültigkeit besitzt, verliert ihre bindende Kraft. Recht wird wieder aus Macht abgeleitet, nicht Macht aus Recht. Moralische Argumente verlieren dort an Wirkung, wo sie nicht mehr von Durchsetzungsfähigkeit begleitet werden.
Diese neue Weltlage verlangt keine Anpassung bestehender Ordnungen, sondern deren grundlegende Neudefinition.
Die liberale Weltordnung als historische Ausnahme
Die sogenannte regelbasierte internationale Ordnung war nie ein Naturzustand. Sie entstand aus einer außergewöhnlichen historischen Konstellation nach 1945 und insbesondere nach 1990: militärische Dominanz der Vereinigten Staaten, wirtschaftliche Globalisierung, institutionalisierter Multilateralismus und ein normativer Konsens über Menschenrechte, Demokratie und offene Märkte.
Der amerikanische Politikwissenschaftler John Mearsheimer bezeichnet diese Phase rückblickend als strategische Illusion. Aus realistischer Perspektive seien Großmächte strukturell nicht bereit, ihre Sicherheitsinteressen dauerhaft einer abstrakten Ordnung unterzuordnen. Die Rückkehr zur Machtpolitik sei keine Abweichung, sondern der historische Normalzustand.
Auch Henry Kissinger betonte wiederholt, dass jede stabile Weltordnung auf einem geteilten Verständnis von Legitimität beruhen müsse. Dieser Konsens ist heute nicht mehr gegeben. Weder zwischen den Großmächten noch innerhalb westlicher Gesellschaften existiert Einigkeit darüber, wer Regeln setzt, wer sie durchsetzt und wessen Werte universelle Geltung beanspruchen dürfen.
Multipolarität ohne Spielregeln
Die neue Welt ist weder bipolar noch stabil multipolar. Sie ist fragmentiert. Macht verteilt sich nicht entlang klarer Achsen, sondern entsteht situativ, themenabhängig und oft kurzfristig. Die Vereinigten Staaten, China und Russland agieren parallel, nicht koordiniert. Regionale Akteure wie Indien, Iran, die Türkei oder Saudi-Arabien verfolgen zunehmend eigenständige Ordnungsmodelle.
Der chinesische Politikwissenschaftler Yan Xuetong argumentiert offen, dass moralische Führung und politische Glaubwürdigkeit entscheidender seien als bloße militärische Stärke. Gleichzeitig definiert China Moral nicht liberal, sondern zivilisatorisch. Stabilität steht über individueller Freiheit, Ordnung über politischer Pluralität.
Damit prallen zwei normative Systeme aufeinander, die nicht kompatibel sind. Die Auseinandersetzung ist weniger territorial als weltanschaulich. Es geht nicht um Einflusszonen, sondern um konkurrierende Definitionen von Legitimität.
Sicherheit neu gedacht: von Abschreckung zu Resilienz
Die klassische Sicherheitslogik des 20. Jahrhunderts greift nicht mehr. Militärische Abschreckung, Bündnissysteme und territoriale Verteidigung bleiben relevant, reichen jedoch nicht aus. Die entscheidenden Bedrohungen sind hybrid: Cyberangriffe, Desinformation, wirtschaftliche Abhängigkeiten, Energieversorgung, Lieferketten, Dateninfrastruktur.
Die Politologin Anne-Marie Slaughter spricht von einem Paradigmenwechsel hin zu Netzwerkresilienz. Sicherheit entsteht nicht mehr allein durch staatliche Macht, sondern durch die Widerstandsfähigkeit ganzer Gesellschaften, Institutionen, Unternehmen und Informationsräume.
Staaten verlieren dabei ihr exklusives Sicherheitsmonopol. Unternehmen, Technologieplattformen und Zivilgesellschaft werden zu sicherheitspolitischen Akteuren. Diese Verschiebung stellt die traditionelle Sicherheitsarchitektur fundamental infrage.
Der Ukrainekrieg als strukturelle Zäsur
Der Krieg in der Ukraine ist keine Ausnahme, sondern eine Zäsur. Er zeigt, dass territoriale Integrität, Völkerrecht und internationale Sanktionen ihre abschreckende Wirkung teilweise verloren haben. Normverletzungen führen nicht mehr automatisch zu Isolation, sondern werden geopolitisch einkalkuliert.
Der Historiker Timothy Snyder beschreibt den Konflikt als Kampf um die politische Realität selbst. Wahrheit, Geschichte und Recht würden gezielt relativiert, um Machtansprüche zu legitimieren. Der Krieg sei daher nicht nur militärisch, sondern epistemologisch.
Die internationale Sicherheitsordnung scheitert nicht an fehlenden Regeln, sondern an der schwindenden Bereitschaft, diese Regeln als verbindlich anzuerkennen.
Der globale Süden und die Abkehr vom westlichen Narrativ
Ein zentraler Aspekt der neuen Weltlage ist die Haltung des globalen Südens. Viele Staaten Afrikas, Asiens und Lateinamerikas verweigern sich der westlichen Interpretation von Recht, Moral und Verantwortung. Sie sehen sich nicht als Teil eines normativen Projekts, sondern als Akteure eigener Entwicklungslogiken.
Der Geostratege Parag Khanna spricht von einer postwestlichen Welt, in der Effizienz, Stabilität und nationale Souveränität höher gewichtet werden als liberale Ideale. Für viele dieser Staaten ist der Westen nicht moralische Referenz, sondern ein Akteur unter vielen, der Regeln selektiv anwendet.
Diese Perspektive untergräbt den universellen Anspruch westlicher Ordnungsvorstellungen.
Wirtschaft als neue Sicherheitsfront
Globalisierung galt lange als Friedensgarantie. Heute wird sie zunehmend als strategisches Instrument genutzt. Sanktionen, Exportkontrollen, Technologiebeschränkungen und Währungsstrategien ersetzen klassische militärische Mittel.
Die Ökonomin Mariana Mazzucato warnt davor, dass Staaten ohne aktive Industrie- und Innovationspolitik ihre politische Souveränität verlieren. Sicherheit bedeutet heute Kontrolle über kritische Ressourcen: Energie, Daten, Halbleiter, Infrastruktur.
Damit verschwimmt die Grenze zwischen Wirtschafts- und Sicherheitspolitik vollständig.
Technologie, KI und die Auflösung klassischer Machtbegriffe
Künstliche Intelligenz, autonome Waffensysteme und algorithmische Informationssteuerung verändern Machtverhältnisse grundlegend. Staaten verlieren ihr Monopol auf strategische Wirkung. Kleine Akteure können disproportionalen Einfluss ausüben.
Der Historiker Yuval Noah Harari warnt davor, dass politische Systeme, die auf menschlicher Entscheidungsfindung basieren, mit der Geschwindigkeit algorithmischer Prozesse nicht mehr Schritt halten können. Sicherheit wird zur Frage technologischer Kontrolle.
Europa zwischen Norm und Macht
Europa steht im Zentrum dieses Spannungsfelds. Es verfügt über normative Strahlkraft, aber über begrenzte machtpolitische Kohärenz. Die Europäische Union verteidigt Werte, ohne über ausreichende Mittel zu verfügen, sie global durchzusetzen.
Der ehemalige EZB-Präsident Mario Draghi betonte mehrfach, dass strategische Autonomie keine Option, sondern eine Notwendigkeit sei. Ohne eigene Sicherheits-, Energie- und Technologiestrategie drohe Europa geopolitische Marginalisierung.
Prinzipien einer neuen Sicherheitsordnung
Die neue Weltordnung wird weder gerecht noch harmonisch sein. Sie kann jedoch realistisch sein.
Macht wird offen benannt und nicht moralisch verschleiert.
Sicherheit wird als gesellschaftliche Resilienz verstanden, nicht als reine Militärstärke.
Normen gelten nur dort, wo sie legitimiert und durchsetzbar sind.
Multipolarität erfordert neue Allianzen, neue Institutionen und neue Narrative.
Schluss: Wahrheit statt Trost
Die vielleicht unbequeme Erkenntnis dieser neuen Weltlage lautet: Das, was wir für richtig hielten, war nicht falsch, aber nicht dauerhaft bindend. Weltordnungen sind keine moralischen Endzustände, sondern temporäre Machtgleichgewichte.
Die Herausforderung besteht nicht darin, die alte Ordnung zu konservieren, sondern eine neue zu gestalten, die der Realität standhält, ohne ihre Menschlichkeit zu verlieren.
Oder, wie Zbigniew Brzezinski es formulierte: Stabilität entsteht nicht aus Wunschdenken, sondern aus dem Mut, die Welt so zu sehen, wie sie ist.